Wolf Schneider
DEUTSCH FÜR PROFIS
Wege zu gutem Stil
Illustriert von Luis Murschetz. – Wilhelm Goldmann Verlag München, April 2001, 17. Auflage, Taschenbuch, 274 Seiten, ISBN 978 3 442 16175 1
VORBEMERKUNG
Ich bin Wiederholungstäter – aus Leidenschaft. Einen Wolf Schneider hatte ich schon in der Reißn: den für »junge Profis«; hier. Es war klar, dass ich weitere Bücher zu mir nehmen würde, und das erste aus einer noch auszubauenden Reihe weiterer Titel war der Klassiker schlechthin, denn die Originalausgabe des Buches stammt aus dem Jahre 1984 (kein Tippfehler, 1984 – das Orwelljahr!) – und hat nichts von seiner Aktualität verloren. Ganz im Gegenteil.
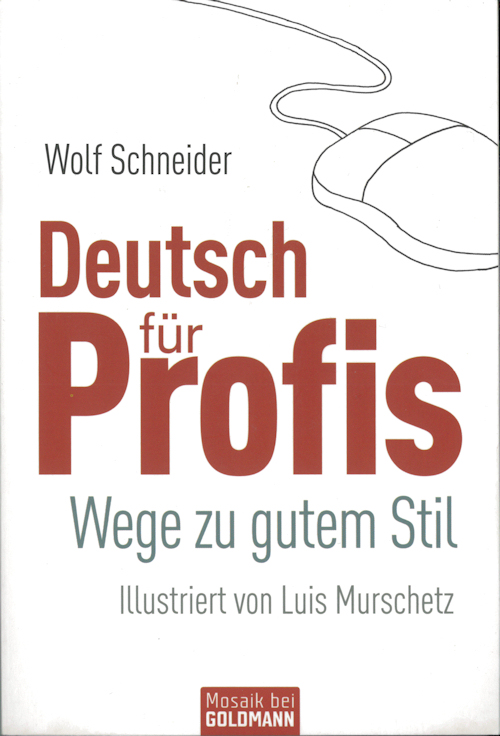
WORUM GEHT ES?
Um die deutsche (Schrift-) Sprache, ihre Verwendung, um das, was (vor allem) Journalisten (aber auch Schriftsteller) mit ihr anstellen, und wie man sie verwendet, um gut, verständlich, interessant und korrekt zu schreiben.
WIE IST DER STIL?
Dem Thema höchst angemessen. Und gut und sehr amüsant zu lesen.
WAS GEFIEL NICHT?
Dass das Buch so kurz ist.
WAS GEFIEL?
Alles.
EIN PAAR ZITATE GEFÄLLIG?
Ich möchte einige Zitate präsentieren, die nicht nur den Stil Schneiders, sondern auch die Themenvielfalt, die man vielleicht gar nicht erwartet, darzustellen. Im Grunde ist die Zahl der Zitate vermeintlich umfangreich, aber tatsächlich reizt das Buch zu sehr viel mehr.
Nicht, dass der Duden immer Recht gehabt hätte. Jeder, der Normen setzt, unterliegt der Kritik. Nur sollte man daraus nicht folgern, dass alle Normen abzuschaffen wären. In der Tat gibt es Normen in den meisten deutschen Redaktionen, gesetzt von Sprachpäpsten und Barrikaden-Kämpfern für grammatische Finessen. Mit ihnen fühlt der Verfasser sich verbündet – was nicht heißen muss, dass wir in allen Punkten gleicher Meinung wären. Uns verbindet die Gesinnung, die dem Duden abhanden gekommen ist: Die Sprache ist ein zu kostbares Medium, als dass wir sie der Trägheit oder der Frechheit fahrlässiger oder mutwilliger Verstümmler überlassen sollten.
(Seite 12, »Der Duden hat kapituliert«)
Unter dem Titel »Experten wollen uns für dumm verkaufen« geht Schneider auf den Zunftjargon ein, die Art und Weise, zu sprechen und zu schreiben, dass es letztlich nur noch Eingeweihte wirklich verstehen zu können glauben. (Oft genug ist in den im Zunftjargon formulierten Aussagen wohl auch gar kein Inhalt mehr vorhanden, was sich mit einer für die Allgemeinheit unverständlichen Sprache trefflich verschleiern lässt.)
Zunftjargon […]
von links:
Wir sind eine Gruppe intellektueller Frauen, die individuell so verschieden und dennoch kollektiv einander so ähnlich sind, dass wir uns zusammengetan haben, wenn auch mit viel Willkür, Ablehnung und Leid. Wir sind vor allem nicht nur intellektuelle Frauen, sondern Intellektuelle, die einerseits die Lage der Frau reflektieren und analysieren und andererseits in gewissem Maße ihre persönliche und soziale Identität in den Beruf eingebracht und dort thematisiert haben. Ich frage mich nun, welche Auswirkungen dieses Zusammenfallen von Objekt und Subjekt nicht nur auf den Wissenserwerb hat, sondern auch auf die Erarbeitung einer weiblichen Identität auf sozialer und kultureller Ebene. In welchem Maße haben wir also dazu beigetragen, eine neue weibliche Identität als kulturell und gesellschaftlich normierte und legitimierte herauszubilden? Inwiefern ist die Ausarbeitung eines neuen Modells ein notwendiger Schritt, damit jede Frau ihre eigene persönliche Identität ausbilden, biografische Abschnitte legitimieren kann, die nicht in den traditionellen Modellen zu finden sind?
Die Tageszeitung (Berlin), 12. 8. 1981
in der Linguistik:
Die »kaleidoskopische Polemik‹ (W. Lepenies) um das Verhältnis eines zwischen Methodologie und panstrukturalistischer Ideologie oszillierenden Strukturalismus zum Marxismus dominierte in den letzten Jahren die theoretische Szene in Frankreich und führte in den Arbeiten der Schule Althussers zu dem Versuch, über die Assimilierung der Ergebnisse der Linguistik, Kybernetik und einer ihrerseits von linguistischen Aporien her interpretierten Psychoanalyse gegenüber den humanistischen Marxismus-Interpretationen eine »szientifizierte« Version marxistischer Theorie zu katalysieren.
Karl Steinbacher, »Sprache als Arbeit und als Markt«, 1972
(Seite 31 f., »Experten wollen uns für dumm verkaufen«)
Gutes Deutsch ist immer zugleich korrektes Deutsch, außer vielleicht bei ein paar wüsten Genies. Doch umfasst es weit mehr als den tadellosen Umgang mit Grammatik, Rechtschreibung und Interpunktion. Gutes Deutsch ist darum noch nicht automatisch leicht verständlich: Kleist oder Thomas Mann beweisen es. Gutes Deutsch ist auch nicht immer interessant: Es kann im Grenzfall eine gewisse erhabene Langeweile abstrahlen wie bei Adalbert Stifter und Hugo von Hofmannsthal, wie in Goethes Altersprosa oder in den Glückwunschtelegrammen des jeweiligen Bundespräsidenten.
(Seite 35, »Was also sollten wir tun?«)
Den äußersten Unfug richten die Adjektive dort an, wo sie die Logik auf den Kopf stellen, weil sie aufs falsche Substantiv bezogen werden. Da der Besitzer eines vierstöckigen Hauses niemals ein vierstöckiger Hausbesitzer ist, kann es auch keine reitende Artilleriekaserne geben.
(Seite 44, »Wie man gut, interessant und verständlich schreibt (I): Die Wörter – Weg mit den Adjektiven!«)
Schneider geht hier auf einige schöne Beispiele deutsch-medialer Sprachverquarkung ein: die »bäuerliche Einkommensschmälerung«, den »umweltpolitischen Maßnahmenkatalog«, das »soziale Problemfeld«, das »atomare Gefahrenbewusstsein« – und die »atlantischen Tiefausläufer«, »obwohl hier doch nicht irgendein Tief atlantisch ausläuft, sondern ein Atlantiktief seine Ausläufer schickt«. Sensationell der Schlusssatz des Kapitels »Von halbseidenen Strumpffabrikanten«: »Wir sollten die geräucherten Schinkenhändler endlich in die redaktionelle Überlegungsphase ziehen und der logischen Widersinnigkeitsproblematik den Garaus machen.«
Scheider dann zu »geblähten, abstrakten Imponiervokabeln«:
In der Tat: Der Geisterfahrer besteht aus vier Silben, der Gegenrichtungsfahrbahnbenutzer aus neun. Schwitzen hat zwei Silben, transpirieren vier; Dauerregen vier Silben, »ergiebige Niederschläge« acht; Stuhl und Tat haben eine Silbe, Sitzgelegenheit und Aktivitäten fünf.
(Seite 64, »Wie man gut, interessant und verständlich schreibt (I): Die Wörter – Das treffende Wort«)
Den Spiegel mag Schneider besonders gern. Als jemand, der ihn nach Möglichkeit regelmäßig liest – wobei das bei mir heißt: alle vier bis fünf Wochen, denn so lange brauche ich für eine Ausgabe –, kann ich die Gründe gut beurteilen, denn ich lese den Spiegel auch, um die bösen, bösen Machenschaften dieser Deutschverhunzer möglichst im Auge zu behalten.
Seit nunmehr 36 Jahren gehört beim Spiegel die Manieriertheit zur Geschäftsgrundlage. Seine Geschäfte gehen gut, insoweit hat er Recht. Traurig ist nur: Was da eine Hand voll Spiegel-Redakteure eingeführt und durchgehalten hat, wird jede Woche fünf Millionen Mal gelesen; und als ob das nicht genügte, werden die Spiegel-Maschen von Tausenden deutscher Journalisten nachgestrickt; und da das immer noch nicht auszureichen schien, hat der Duden sich entschlossen, den Spiegel unter seine Quellen aufzunehmen, kommentarlos, versteht sich – sodass die millionenfach multiplizierten Marotten nun auch noch mit dem Anschein der Korrektheit versehen worden sind.
(Seite 81, »Wie man gut, interessant und verständlich schreibt (I): Die Wörter – Weg mit den Marotten!«)
Da der Spiegel mit seiner Meise Geld verdient, möge er sie füttern. Für ihn liegt darin eine wenigstens kaufmännische Vernunft. Die Nachahmer jedoch sollen sich fragen, ob solcher Sprachdurchfall nicht das bleiben könnte, was er eine Zeit lang konkurrenzlos war: ein Markenzeichen des Spiegels. Und ob der deutschen Sprache außer selbstverliebten Wortjongleuren nicht auch ein paar richtige Liebhaber zu gönnen wären.
(Seite 84, »Wie man gut, interessant und verständlich schreibt (I): Die Wörter – Weg mit den Marotten!«)
Noch ein hübsches Spiegel-Beispiel:
Asmodi, ein Mann von Kunstverstand und samtiger Salondämonie, erregt selten Vivat-Rufe deutscher Kunstsachverständiger: Seine Werke entraten engagierten Wackersinns und neigen zu satirischer Stil-Equilibristik. (Der Spiegel, 52/1967)
(ebda.)
Schneider widmet sich auch dem Thema »Zuhören und feilen« und rät dabei zu einer Vorgehensweise, die ich – als Verleger, Lektor und Korrektor in Personalunion – nicht nur vielen, nein, allen Schreibern nur wärmstens empfehlen kann (und ehrlich gesagt: Wenn ich könnte, würde ich sie dazu zwingen wollen!):
Zuhören und feilen
Von der Schrift zur Rede lässt sich eine Brücke schlagen mit einem einfachen Trick: Soll der Text länger halten als bis zum nächsten Tag, so lese man ihn laut vor, einem anderen oder sich selbst. Es ist überraschend heilsam, das Geschriebene dem Gehörtwerden auszusetzen: Kleine Unebenheiten, über die der schweigende Leser hinweghuschte, erweisen sich als Stolpersteine; Füllwörter und ungewollte Wiederholungen stellen sich plötzlich borstig auf; bei hölzernem Rhythmus kracht es hörbar im Gebälk; und Sätze, die uns kurzatmig oder langatmig geraten sind, entlarvt unser keuchender Atem. Schreibe für die Ohren!
So ist das laute Lesen ein wichtiger, vielleicht der eigentlich unentbehrliche Teil jener Arbeit, auf die viele Schreiber die Hälfte ihrer Zeit verwenden oder noch mehr: am Manuskript zu basteln und zu feilen. Drei Viertel sogar, sagte Fontane – drei Viertel seiner ganzen literarischen Tätigkeit seien das Korrigieren und Feilen gewesen. Wie er’s trieb, hat er nicht übermittelt. Ich treibe es so:
- Laut lesen.
- Dabei oder danach: die meisten Füllwörter und möglichst viele Adjektive streichen; bei fahrlässigen Wiederholungen andere Wörter einsetzen; rote Schlangenlinien an Stellen des Missvergnügens machen.
- Den logischen Ablauf prüfen.
- Den dramaturgischen Aufbau prüfen.
- Alle Stellen überarbeiten, die eine Schlangenlinie bekommen haben.
- Die Passagen überarbeiten, die den Gegenlesern missfallen haben.
- Noch mal laut lesen.
Das klingt mühsam und zeitaufwändig. Bei allen Texten, die ich für wichtig hielt, habe ich es gleichwohl so gehalten. Wenn ich nach all den Mühen einen Text immer noch missraten finde, greife ich zum letzten Mittel: Ich schreibe ihn noch einmal, ganz von vorn, mit nur gelegentlichem Blick auf die verworfene Fassung, und mit der Hand natürlich.
(Seite 128 f., »Wie man gut, interessant und verständlich schreibt (II): Die Sätze – Soll man schreiben, wie man spricht?«)
2. Der Doppelpunkt abseits der Spiegel-Masche. Da der Spiegel die halbe Branche daran gewöhnt hat, dass der einzige Zweck des Doppelpunkts ein ritualisierter Unsinn sei, wird der Doppelpunkt immer seltener dort verwendet, wo er dringend hingehört, weil er Zusammenhänge anschaulich macht und Sätze gliedert. (…)
(Seite 169, »Wie man verständlich schreibt – Die verschenkte Interpunktion«)
Wer es wagt, als Ratgeber für korrektes Deutsch auf den Plan zu treten, der wird sogleich von drei Einwänden überfallen: erstens, dass es sich um ein uferloses Thema handle; zweitens, dass Profis selbstverständlich am besten wüssten, was richtig ist; und drittens, dass es altmodisch sei, die Frage des korrekten Sprachgebrauchs, der grammatischen Normen, der Rechtschreibung nach dem Duden allzu wichtig zu nehmen. Die Sprache wachse und ändere sich wie jedes Lebewesen; »scheinbar« gegen »anscheinend« abzugrenzen sei eine Pedanterie; und wenn das Volk keinen korrekten Konjunktiv mehr wolle, dann möge der korrekte Konjunktiv eben sterben, und wer dagegen sei, könne ohnehin nichts ändern.
(Seite 215, »Wie man korrekt schreibt – Volkes Maul ist nicht genug«)
Es war schon immer so, dass Feinheiten oder zusätzliche Verfeinerungen der Grammatik nicht von Landarbeitern und Halbwüchsigen ersonnen oder hochgehalten wurden, sondern von Dichtern, Mönchen und Lehrern; das Volk neigt zu saftigem Ausdruck in schlampiger Form. Jahrtausendelang hat sich das Volk nicht gegen die Lehrer und Mönche durchgesetzt; und da wir mit dem Ergebnis, nehmt alles nur in allem, doch zufrieden sind, muss die Frage erlaubt sein, warum Lehrer und Journalisten plötzlich vor der uralten Formfaulheit des Volkes kapitulieren sollen. (Bloß weil die Mönche fehlen?)
(Seite 216, »Wie man korrekt schreibt – Volkes Maul ist nicht genug«)
hinterfragen: Soziologenjargon bis zur Karikatur seiner selbst; nach Hans Weigel »aus dem Anus der deutschen Sprache ausgeschieden«.
(Seite 231, »Wie man korrekt schreibt – Schludereien und Marotten«)
Mexiko-City ist Unfug. Eine spanischsprachige Stadt können wir Spanisch oder Deutsch benennen. – aber warum Englisch? Spanisch (amtlich!) Ciudad Mexico. Deutsch: Mexiko-Stadt, die Stadt Mexiko, oder einfach: Mexiko, denn nur selten bleibt unklar, ob man Stadt oder Land meint.
(Seite 233, »Wie man korrekt schreibt – Schludereien und Marotten«; hier zeigt Schneider, dass auch er zu irren in der Lage ist: Es muss heißen »Ciudad de Mexico«; aber das ist Spanisch, folglich nicht seine Baustelle)
Schnitt: Kaufmannsjargon für »Durchschnitt« (im Schnitt). Noch nicht eingebürgert: schnittlich für durchschnittlich.
(Seite 235, »Wie man korrekt schreibt – Schludereien und Marotten«)
ZU EMPFEHLEN?
Unbedingt. Unbedingt unbedingt. Un–be–dingt. Die Bücher von Wolf Schneider sind in meinen Augen für jeden Schreiber ebenso unverzichtbar wie der Duden (trotz allem) und der Wahrig.
NOCH WAS?
Mitunter überlege ich, solche Lektüre zukünftig zu unterlassen. Ich kann inzwischen keine Zeitung mehr lesen, keine Nachrichten mehr hören, kein Fernsehen mehr schauen, ohne dass mir der alltägliche und allgegenwärtige »Umgang« mit der deutschen Sprache ins Ohr geht und aufs Auge fällt. Wie ungeschickt, gar ungebildet, vielleicht auch nur dumm ein Großteil der deutschen Bevölkerung im Umgang mit der eigenen Sprache ist, ist dabei nicht einmal das Problem. Es ist vielmehr die Tatsache, dass es die Profis sind, die »selbstverständlich wissen müssen, was richtig ist«, die an Ungeschicklichkeit, mangelhafter Bildung und ausgeprägter Dummheit dem Volke nicht nur nicht nachstehen, sondern sich auch den Vorwurf gefallen lassen müssen, es absichtlich zu tun!
